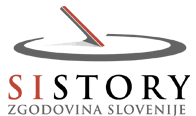
/
Serijske publikacije
/
Zgodovina za vse
»Jedel je prav malo, kakor je bila njegova navada. Pilje več.«
Ivan Cankar, slovenski bohem - prispevek k zgodovini bohemstva na Slovenskem

Avtor(ji):Jernej Kosi
Soavtor(ji):Janez Cvirn (ur.)
Leto:2004
Založnik(i):Zgodovinsko društvo, Celje
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Ključne besede:biografije, kulturna zgodovina, način življenja, korespondenca, cultural history, biographies, correspondence
Avtorske pravice: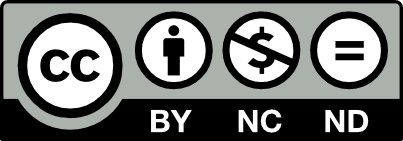
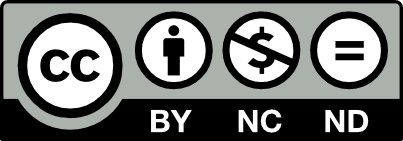
To delo avtorja Jernej Kosi je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna
Datoteke (1)

Ime:Zgodovina za vse 2004-1.pdf
Velikost:5.28MB
Format:application/pdf
Stalna povezava:https://hdl.handle.net/11686/file61678
Opis
V prispevku je predstavljena po mnenju avtorja vse preveč zamolčana vsakdanjost življenja Ivana Cankarja, enega najpomembnejših
slovenskih pisateljev. Avtor na začetku postavi trditev, da je bil Cankar bohem, saj so ga kot takega označevali
sodobniki, pa tudi sam je svoje življenje na Dunaju primerjal z življenjem »parižkih bohemov«. Ker je bilo bohemstvo kot
način bivanja vseevropska značilnost druge polovice 19. in začetka 20. stoletja, podaja avtor v prvem delu splošno sliko
tega fenomena, v katero potem v drugem delu poskusi umestiti Cankarja.
Metapodatki (12)
- identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/2211
- naslov
- »Jedel je prav malo, kakor je bila njegova navada. Pilje več.«
- Ivan Cankar, slovenski bohem - prispevek k zgodovini bohemstva na Slovenskem
- »He was wont to eat very little and to drink much more.«
- Ivan Cankar, Slovene Bohemian - A Contribution to the History of Bohemianism in Slovenia
- „Er aß recht wenig, wie es seine Dewohnheit war. Er trank mehr."
- Ivan Cankar, ein slowenischer Bohemien - ein Beitrag zur Geschichte der Boheme auf slowenischem Gebiet
- avtor
- Jernej Kosi
- soavtor
- Janez Cvirn (ur.)
- predmet
- biografije
- kulturna zgodovina
- način življenja
- korespondenca
- cultural history
- biographies
- correspondence
- opis
- The article presents what the author believes to be the far too hushed-up everyday life of Ivan Cankar, one of the most important Slovene writers. To begin with, the author makes a firm statement that Cankar was a bohemian, since his contemporaries called him that, and he himself even compared his life in Vienna to the life of the »bohemians of Paris«. Since bohemianism as a way of life was a characteristic feature of society throughout Europe in the second half of the 19th century and the early 20th century, the author gives a general picture of the phenomenon in the first part of his article, followed by a look at how Cankar fitted into this frame.
- V prispevku je predstavljena po mnenju avtorja vse preveč zamolčana vsakdanjost življenja Ivana Cankarja, enega najpomembnejših slovenskih pisateljev. Avtor na začetku postavi trditev, da je bil Cankar bohem, saj so ga kot takega označevali sodobniki, pa tudi sam je svoje življenje na Dunaju primerjal z življenjem »parižkih bohemov«. Ker je bilo bohemstvo kot način bivanja vseevropska značilnost druge polovice 19. in začetka 20. stoletja, podaja avtor v prvem delu splošno sliko tega fenomena, v katero potem v drugem delu poskusi umestiti Cankarja.
- Das tägliche Leben des großen slowenischen Schriftstellers Ivan Cankar wird im Bildungsprozeß der Volks- und Mittelschulen meist beschönigt beziehungsweise verschwiegen. Auch seine „offiziellen" Biographien sprechen nur selten von seinen Schwierigkeiten mit dem Alkohol, und das trotz der Fülle an Daten, die in den Memoiren seiner Zeitgenossen und in Cankars persönlicher Korrespondenz zu finden sind. Eine Erklärung dafür ist, daß sich die Slowenen als moderne politische Nation auf Grundlage des Bewußtseins von einer Gemeinschaft, die Slowenisch spricht, ausgebildet haben. Folglich wurde die heimische Literatur immer als besonders wichtiges Gebiet verstanden, das frei von allen unschicklichen Details sein muß. Cankar selbst verstand sich als Bohemien, schrieb er doch in einem Brief aus Wien an seinen Bruder, daß er das Leben eines Bohemien führt. Auch Cankars Zeitgenossen sahen ihn als Bohemien. Die Boheme als Lebenspraxis wurde in das slowenische Gebiet importiert. Erste Niederschriften über die Boheme als besondere Lebensart tauchen in Frankreich in den Jahren 1830 bis 1840 auf. Die Ursachen für das Auftreten der Boheme liegen laut Elizabeth Wilson in der Wende nach der Französischen Revolution, die eine postrevolutionäre Industrialisierung ermöglichte, mit der das Mäzenatentum als vorherrschende Unterstützungsform für künstlerisches Schaffen den Gesetzen des freien Marktes weichen mußte. Die Boheme ist so die Antwort der Künstler auf die geänderten Verhältnisse; ein Kulturmythos, der die imaginäre Lösung des Kunstproblems in den westlichen Industriegesellschaften ermöglichte. Cankar begann sein Leben als Bohemien nach seiner Ankunft in Wien, wo er als erstes die Mitarbeit im Verein slowenischer Studenten „Slovenija" ablehnte, weil ihm das übermäßige Feiern der Studenten nicht gefiel. Mit Gleichgesinnten gründete er daraufhin einen literarischen Klub. Noch vor seiner Ankunft in Wien entwickelte Cankar eine spezifische Ökonomie des Überlebens - basierend auf Autorenhonoraren, Vorschüssen und fortwährendem Ausleihen von Geld -, die ihn bis zu seinem Tod begleitete und ihm im Ater ein relativ bequemes Leben ermöglichte. In seinen besten Jahren waren seine Honorare für damalige slowenische Verhältnisse vergleichsweise hoch. Seine ständige Geldknappheit ist seiner Nachlässigkeit zuzuschreiben. Angeblich hatte er nicht einmal eine Brieftasche und Kronen lagen in allen seinen Kleidertaschen herum. Seine endgültige Rückkehr von Wien nach Ljubljana Ende 1909 gilt als Wende in seinem Leben, die den Beginn seines physischen und künstlerischen Niedergangs markiert. Die Erinnerungen seiner Zeitgenossen betreffen vor allem diese Periode und beschreiben Cankar als jemanden, der viel trank, obwohl er schon durch kleinere Mengen an Wein „umgeworfen" wurde. In seinen letzten Lebensjahren soll er unter Alkoholeinfluß auch geschrieben haben. Nachrichten über Cankars Leben als Bohemien verbreiteten sich anscheinend sehr rasch im Lande Krain und im breiteren slowenischen Gebiet, denn schon 1912 initiierten angesehene slowenische Bürger eine Aktion, mit der sie Cankar aus seinen Lebensnotlagen helfen wollten. Sie waren aber erfolglos. Nach seinem schicksalhaften Sturz auf einer Treppe, mitbedingt durch starke Trunkenheit, wurde Cankar am 29. Oktober 1918 das erste Mal ins Krankenhaus eingewiesen. Nach seiner Entlassung kam er am 25. November wieder ins Krankenhaus und starb dort am 11. Dezember 1918. Es ist eigentlich erstaunlich, daß über das tägliche Leben des großen Schriftstellers hauptsächlich geschwiegen wird, geht es doch bei Cankar um einen der prominentesten slowenischen Bohémiens vor dem Ersten Weltkrieg, der in die verschlafene und periphere Laibacher (klein)bürgerliche Szene eine Prise kosmopolitischen Geistes, Denkens und Verhaltens einführte, an denen eklatanter Mangel herrschte.
- založnik
- Zgodovinsko društvo
- datum
- 2004
- tip
- besedilo
- jezik
- Slovenščina
- jeDelOd
- pravice
- licenca: ccByNcNd
Citirano v (1)
| Tipologija | Avtor(ji) | Naslov | Kraj | Založba | Leto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 Izvirni znanstveni članek | Lešnjak, Simona | Srebro golk, zlato molk | Celje | Zgodovinsko društvo | 2012 |
Seznam literature v delu (1)
| Stran | Avtor | Naslov | Vir | Kraj | Založba | Leto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Studen, Andrej | Stanovati v Ljubljani : socialnozgodovinski oris stanovanjske kulture Ljubljančanov pred prvo svetovnovojno | Ljubljana | ISH | 1995 |